11. Sept. 2025
Was Mitarbeitende beitragen können für mehr psychologische Sicherheit
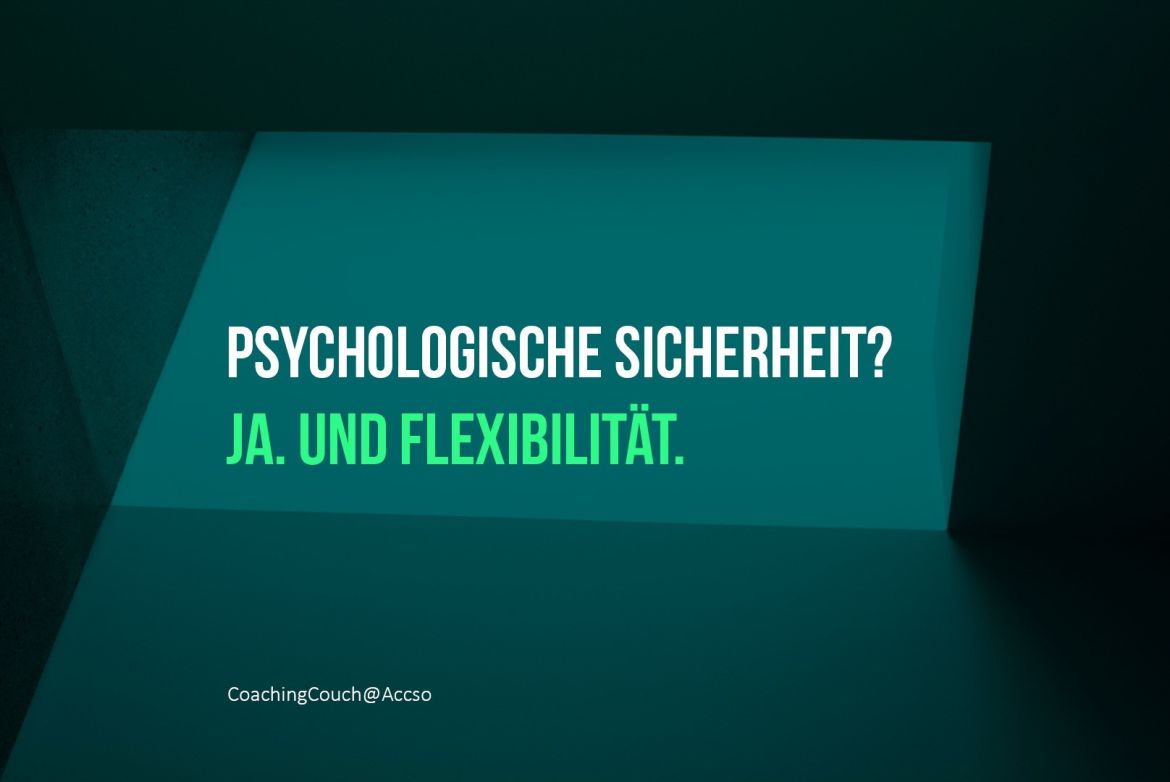
Psychologische Sicherheit
Mit psychologischer Sicherheit wird ein Arbeitsumfeld beschrieben, in dem Menschen sich offen äußern können – mit all ihren Wünschen, ihrer Kritik und ihren Sorgen – ohne Sanktionen oder Scham befürchten zu müssen. Es geht um ein vertrauensvolles Miteinander, über Hierarchiegrenzen hinweg, dem u.a. eine bessere Fehler- und Innovationskultur nachgesagt werden.
Ich finde dieses Konzept sehr einfach und wertvoll, finde es aber nicht trivial einzuführen und nachhaltig zu festigen. Mir sind dabei zwei Dinge aufgefallen, die das Etablieren einer solchen psychologischen Sicherheit erschweren können:
Unsichtbare Grenzen
Menschen machen Fehler, teils auch gravierende und unternehmenskritische, und diese müssen deutlich ansprechbar sein und sie können Folgen haben – natürlich möglichst ohne die entsprechende Person in ihrer Identität anzugreifen. Dennoch gilt auch in einer psychologisch sicheren Umgebung, dass Handeln Konsequenzen nach sich zieht – für die sich Menschen auch manchmal schämen, sich erklären müssen oder im Extremfall gekündigt werden.
Zudem gibt es Ausrichtungen einer Abteilung oder eines ganzen Unternehmens, die manchen Mitarbeitenden missfallen. Trotz der Möglichkeit, die eigenen Bedenken vertrauensvoll äußern zu können, müssen diese Menschen akzeptieren, dass anders und unabhängig davon entschieden werden kann. Das heißt, sie müssen die Spannungen aushalten zwischen der Offenheit und Freiheit, die psychologische Sicherheit bietet, und den Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit, die z.B. durch organisatorische Strukturen und Rollen oder auch einfachen zwischenmenschlichen Grenzen bestehen.
Es kann also missverständlich der Eindruck entstehen, dass durch mehr Möglichkeit, sich zu äußern, automatisch mehr Handlungsspielraum entsteht. Und das ist nicht zwangsläufig gegeben. Werden die betroffenen Personen nicht auf diese Grenzen vorbereitet, stoßen sie irgendwann vermutlich selbst darauf. Zu den möglichen Reaktionen gehören Frust und ein Gefühl der Täuschung. So sicher wie wir dachten, sind wir gar nicht.
Verortung auf Führungsebene
Mein persönlicher Eindruck ist, dass für die psychologische Sicherheit oder Unsicherheit in erster Linie die entsprechenden Führungspersonen verantwortlich gesehen werden. Die sollen, flapsig formuliert, die nötigen Rahmenbedingungen und die Kultur herstellen, damit die Belegschaft psychologisch sicher arbeiten kann.
Einerseits ist da was dran: Führungskräfte haben mehr Einfluss auf Rahmenbedingungen und Sanktionen als andere Mitarbeitende. Insofern beeinflussen sie auch (bewusst oder unbewusst), wie unbekümmert oder ängstlich sich Menschen mit Blick auf mögliche Sanktionen äußern. Durch ihre Position haben sie zudem eine Vorbildfunktion, an der sich die Mitarbeitenden mit ihrem Verhalten in gewissem Rahmen orientieren.
Andererseits greift der Fokus auf die Führungskräfte zu kurz: Kultur lässt sich nicht herstellen, sondern sie entsteht durch die kontinuierliche Kommunikation und Handlungen aller Beteiligter. Insofern lässt sie sich zwar „von oben“ beeinflussen, aber es sind immer alle Menschen einer Gemeinschaft an der Entwicklung einer Kultur beteiligt - damit auch an einer Kultur mit hoher psychologischer Sicherheit.
Ein Gemeinschaftsprojekt
Ich denke, eine Veränderung hin zu mehr psychologischer Sicherheit, ist wie auch andere kulturbezogene Changes, dann wirklich erfolgreich, wenn sich alle Beteiligten von Beginn an klar sind:
- Das ist eine Lernerfahrung: Wir haben nicht von Anfang an alle Antworten auf alle Fragen parat und tasten uns heran an die Situation, die für uns am besten passt. Beispielsweise wissen wir zwar, dass es Grenzen der Handlungsmöglichkeiten geben wird, aber wir lernen sie erst im Verlauf der Veränderung wirklich kennen – können sie also noch nicht vollständig ziehen und transparent machen.
- Wir packen alle mit an: Unsere Arbeitskultur entsteht durch das, was wir alle ständig sagen und tun – nicht durch das, was jemand für uns definiert. Das heißt auch, dass wir unser eigenes Handeln stärker wahrnehmen und ggf. anpassen müssen.
Diese Veränderung wird dadurch selbst psychologisch sicherer und bezieht mögliche Fehler von Anfang an mit ein.
Akzeptanz und psychische Flexibilität
Die Arbeit mit Führungskräften ist wichtig, um eine psychologisch sicherere Umgebung zu schaffen. Mindestens ebenso relevant sehe ich aber auch die Arbeit mit allen Beteiligten – vor allem an den Kompetenzen zu Akzeptanz und psychischer Flexibilität.
Wenn sich alle zu allem äußern können, bedeutet das auch, dass ich sehr viel hören werde, was mich entweder nicht betrifft oder mir nicht gefällt. In einer psychologisch sicheren Umgebung muss ich das aushalten können. Und „können“ ist hier wörtlich gemeint – Akzeptanz lässt sich trainieren. Und zumindest die Bereitschaft dazu ist etwas, das alle Mitarbeitenden beitragen können.
Im Konzept der psychischen Flexibilität, maßgeblich nach Steven C. Hayes, ist Akzeptanz ein Kernbestandteil - als Fähigkeit, Unangenehmes aushalten zu können. Psychisch flexible Menschen sind in der Lage, in Richtung übergeordneter Werte zu handeln, obwohl es Störfaktoren (aus dem äußeren oder inneren) gibt.
Folgt man dieser Idee von psychischer Flexibilität noch einen Schritt weiter, in Richtung Team- und Organisationsentwicklung, können sich die folgenden Arbeitsfelder für und mit Mitarbeitenden ergeben:
- Klärung der Werte und wie sie zu den übergeordneten Team-/Abteilungs- und Unternehmenswerten passen: Was ist mir wirklich wichtig? Worauf bin ich nicht bereit zu verzichten? Und wie gut passt das mit den Werten meiner Umgebung zusammen?
- Training der Aufmerksamkeit und ihrer Steuerung: Wie kann ich schnell und emotional unbelastet wahrnehmen, was um mich herum und in mir passiert (als Vorurteil oder Reaktion)?
- Akzeptanz: Wie kann ich unangenehme Situationen aushalten, die durch eine psychologisch sichere Umgebung entstehen können (z.B. Konfliktgespräche)? Geht das auch ohne, dass ich nervös, frustriert oder wütend werde?
Alle drei Arbeitsfelder lassen sich sehr gut entwickeln und damit auch die Voraussetzungen für eine nachhaltig psychologisch sichere Umgebung schaffen. Dazu kann die Unterstützung durch Coaches sehr hilfreich sein, besonders wenn sie zu psychischer Flexibilität, bzw. Akzeptanz- und Commitment-Training (ACT) geschult sind.
Das fehlende Puzzlestück
Für mich persönlich ist psychische Flexibilität eine hervorragende Ergänzung zum Konzept der psychologischen Sicherheit. Wenn ich weiß, was mir wichtig ist und das mit den Werten meines Umfelds zusammenpasst, dann kann ich auch gut aushalten, wenn es gerade unangenehm ist. Und ich bin mir meiner eigenen Handlungsmöglichkeiten bewusster, schöpfe sie aus, anstatt darauf zu warten, dass jemand anderes für mich die Rahmenbedingungen bereitstellt, die mir ein sicheres Arbeiten ermöglichen.
Nicht zuletzt: Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, liegt immer auch in der Hand aller Beteiligter. Führung ist wichtig, aber nicht alles.


